Krebstest sucht statt Tumor-DNA nach verlässlicher nachweisbaren Zuckermolekülen
Viele Krebsarten lassen sich nicht zeitig anhand ihrer DNA im Blut nachweisen. Veränderte Zuckermoleküle könnten sie anzeigen, wenn die Tests genauer werden.
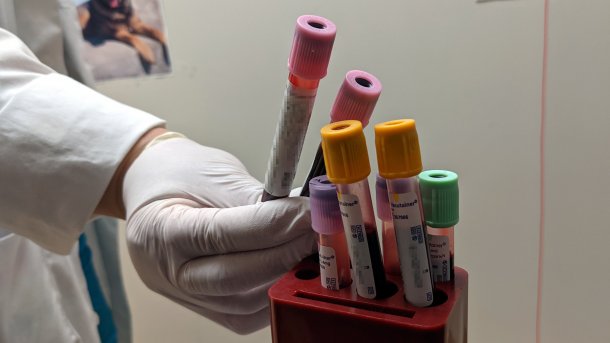
Blutproben in Röhrchen unmittelbar nach der Blutabnahme
(Bild: Daniel AJ Sokolov)
- Veronika Szentpetery-Kessler
Blut- und Urinuntersuchungen spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Krebsfrüherkennung. Diese Flüssigbiopsien können verraten, ob sich im Körper entartete Zellen breitmachen: Entweder noch bevor Tumore groß genug für andere Nachweisformen oder diese zu riskant sind, wie etwa in späteren Stadien bei Tumoren, bei denen wie im Gehirn oder der Lunge Nadelbiopsien für Gewebeproben vorgenommen werden. Weil sich nämlich von vielen Geschwüren immer wieder tote Zellen ablösen, deren Erbgut verräterische Mutationen enthält, kann man im Blut nach dieser DNA fahnden.
Bei mehr als 30 Krebsarten, die für 50 Prozent aller weltweiten Fälle und einem Drittel der Todesfälle verantwortlich sind, lässt sich allerdings nicht genug DNA aufspüren. Deshalb haben sich Forschende an der Chalmers University of Technology in Göteborg 14 Krebsarten angesehen, um besser erkennbare Krebsmarker für die Vorsorge zu finden. Fündig wurden sie bei Zuckermolekülen namens Glykosaminoglykanen (GAG). Diese haben im Körper viele Aufgaben und kommen deshalb im Blut häufig vor. Bei Krebserkrankungen werden sie allerdings erkennbar anders aufgebaut.
Krebstest: Zuckermoleküle im Visier
Die Forschenden um Sinisa Bratulic kartierten zunächst bei knapp 553 Krebspatienten und 426 gesunden Probanden die GAG-Zuckermoleküle im Blut. Bei 220 Kranken und 340 Gesunden untersuchten sie die Moleküle auch im Urin. Die im Fachjournal PNAS veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass schon in der frühen Krebsphase 1 charakteristische GAG-Signaturen auftreten. Aus ihnen ließen sich nicht nur Hinweise auf die Krebsart, sondern auch auf den Ort des Tumors herauslesen. Anschließend suchten die Wissenschaftler in den Blut- und Urinproben von 170 Probanden mit Krebsdiagnose nach diesen Signaturen und verglichen sie mit jenen von 110 gesunden Probanden.
Die Ergebnisse sind vorerst durchwachsen. Bei den Bluttests erkannten die Tests zwar 95 Prozent der gesunden Signaturen korrekt als krebsfrei, also als richtig negativ (Spezifität). Das bedeutet aber auch, dass das Ergebnis in fünf Prozent der Fälle falsch positiv war. Vor allem aber erkannte der Test Krebsfälle bei Bluttests nur zu 41,6 Prozent als richtig positiv (Sensitivität). Bei mehr als der Hälfte der Probanden zeigte er die vorliegende Erkrankung also nicht an. Bei den Urinproben fiel das Ergebnis leicht besser aus. Hier erkannte der Test 62,3 Prozent der Krebsfälle richtig. Sechs von zehn Probanden mit Krebs erhielten also eine richtige Diagnose.
Kostengünstigere Analyse als bei DNA
Entsprechend gemischt fällt das Urteil externer Krebsforscher aus. "Diese Vorgehensweise ist in mehrfacher Hinsicht spannend", sagt Almut Schulze, die am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg die Abteilung Tumormetabolismus und Microenvironment leitet. GAGs seien einfacher als die DNA eines Tumors und damit leichter und vor allem billiger zu analysieren als die im Blut zirkulierende DNA. Die Forschenden gehen von gerade mal 50 Dollar aus.
Allerdings "dürften bestimmte Erkrankungen wie etwa das metabolische Syndrom [Sammelbezeichnung für verschiedene Krankheiten und Risikofaktoren; Anm. d. Red.] die Aussagekraft des Tests verfälschen, weil sich durch derlei Erkrankungen auch die GAGs verändern und dann womöglich zu einem falsch positiven Test führen", so Schulte weiter. "Metabolische Syndrome oder bestimmte entzündliche Erkrankungen sind insbesondere im Alter keine Seltenheit."
Aber auch wenn die Testqualität noch verbessert und in größeren Studien mit mehr Probanden validiert werden müsse, "könnte die Analyse von Glykosaminoglykanen interessant sein für die Krebsfrüherkennung", ergänzt Edgar Dahl von der Uniklinik RWTH Aachen. Die Studienautoren haben für die Weiterentwicklung ihres Flüssigbiopsietests das Start-up Elypta gegründet.
(vsz)