Wie Indien aus eigener Kraft eine Solar-Industrie aufbauen will
Wirtschaftsminister Robert Habeck reist nach Indien und strebt eine engere Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien an. Ein Einblick in Indiens Solarbranche.
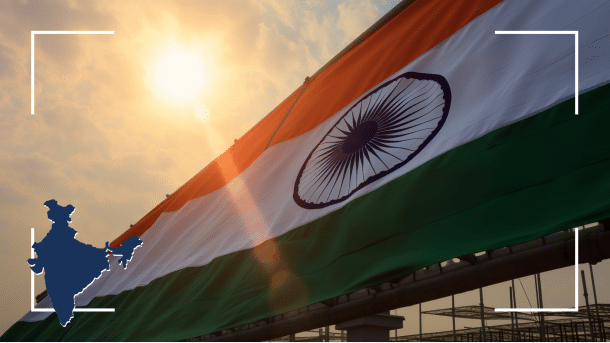
(Bild: Generiert mit Midjourney durch MIT Technology Review)
- Hanns-J. Neubert
- Jennifer Lepies
Dass Indien seit dem 14. April 2023 das bevölkerungsreichste Land der Welt darstellt, hat mit Sicherheit die Relevanz des Subkontinents erhöht. Gerade im Hinblick auf die Handelsabhängigkeiten von China gewinnt Indien an Attraktivität. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck macht das mit seiner dreitägigen Indienreise deutlich – ohne, auf der Reise China einen Besuch abzustatten. "Die Reise steht damit auch im Zeichen von mehr Resilienz und mehr Diversifizierung. Eine engere Zusammenarbeit gerade bei erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff birgt viel Potenzial für beide Seiten und kann unsere Resilienz und Wirtschaftssicherheit erhöhen“, ließ der Minister vor seinem Abflug gegenüber der dpa verlauten.
Teil der begleitenden Wirtschaftsdelegation ist auch der Präsident des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW), Jörg Ebel. "Deutschland wird seinen Photovoltaikausbau in den nächsten vier Jahren verdoppeln. Das wird eine riesige Kraftanstrengung, bei der wir jede Hilfe brauchen können", so Ebel und spielt damit auf Rohstoffe, Solarkomponenten und Fachkräften an. "Indien hat gut ausgebildete Fachkräfte, von denen uns viele gerne bei der Installation von Solaranlagen unterstützen möchten", meint Ebel.
Doch auch Indien selbst hat ambitionierte Pläne, was den Ausbau der heimischen Solarbranche angeht. Das zeigt etwa der Solarpark Bhadla in der Großen Indischen Wüste (Thar) im Gebiet des Bundesstaates Rajasthan. Mit einer Fläche von 56 Quadratkilometern und einer installierten Kapazität von 2,2 Gigawatt liefert er beeindruckende Zahlen und war bis zur Inbetriebnahme des Solarparks Golmud in China im Jahr 2020 der größte Solarpark der Welt.
Die indische Regierung hat das ambitionierte Ziel, den Subkontinent bis 2070 klimaneutral zu bekommen. Der Solarenergie fällt dabei eine besondere Rolle zu. 2014 gab Premierminister Narendra Modi in der "Nationalen Solar Mission" das Ziel vor, bis 2022 mindestens 100 Gigawatt Solarenergie zu installieren. Es wurde um 30 Prozent verfehlt.
Damit die Mission ihr nächstes Ziel schafft – nämlich in den kommenden sieben Jahren 500 Gigawatt aus erneuerbaren Energiequellen zu erreichen – müsste das Land seine Anstrengungen verdreifachen. Die Solarenergie soll im Zielrahmen 280 Gigawatt beisteuern.
33 Prozent an Strom aus erneuerbaren Quellen in Indien
Heute hat Indien eine Photovoltaik-Kapazität von fast 63 Gigawatt installiert, davon nur 1,7 Gigawatt außerhalb der Verteilnetze vorwiegend auf Dächern, wie die Internationale Agentur für Erneuerbare Energie IRENA in ihrer aktuellen Statistik zur erneuerbaren Energie auflistet. Das sind insgesamt zwar weniger als die knapp 66,5 Gigawatt, die derzeit in Deutschland installiert sind, aber das Wachstum beeindruckt dennoch: 2022 erhöhte sich die Solarstromkapazität in Indien um 13,5 Gigawatt, in Deutschland dagegen nur um sieben Gigawatt. Damit schaffte es der Subkontinent mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern immerhin auf einen regenerativen Stromanteil von 33,7 Prozent.
Nach Schätzungen der Zentralen Energiebehörde Indiens (CEA) könnte die prognostizierte Solarkapazität des Landes bis 2030 von 292,6 Gigawatt in sieben Jahren die fossile Erzeugungskapazität von dann 276,5 Gigawatt übertreffen. Aber bis dahin wird dennoch die Kohle mit 54,5 Prozent weiterhin die dominierende Quelle der Stromerzeugung sein – selbst wenn die Solarzellen mehr Strom liefern, als die Kohlekraftwerke. Denn der Ausbau der Erneuerbaren wird lediglich den steigenden Bedarf des Wirtschaftswachstums decken und somit werden sich auch die CO2-Emissionen nicht verringern, wie Aniruddh Mohan, Energiepolitik-Experte am Andlinger Center for Energy and the Environment der Princeton University konstatiert.
Indien gehört zu den Ländern, die in erster Linie auf zentrale Großanlagen setzen. Aber genau das birgt Konfliktpotenzial. "Die besten Standorte sind schon vergeben und der Kauf neuen Landes wird immer schwieriger", stellt Mohan fest. Zuletzt entlud sich so ein Konflikt am 53 Quadratkilometer großen Pavagada-Solarpark im südindischen Bundesstaat Karnataka (der derzeit weltweit drittgrößte Solar-Park) durch dessen Bau sich die soziale Lage der Anwohner dramatisch verschlechterte, wie Forscher der Universität Sydney und der Technischen Universität Sydney beobachten konnten.
Siddharth Sareen und Shayan Shokrgoza von den Universitäten Bergen und Stavanger in Norwegen kommen in einer Untersuchung deshalb auch zu dem Schluss, dass für einen umfassenden Zugang zu sauberer Energie dezentralisierte Energiesysteme für Indien unerlässlich seien, die aber bisher kaum in den Plänen berücksichtigt sind. Nur der indische Teilstaat Uttar Pradesh unterstützt bisher seine Bauern und Bürger umfangreich, indem er ihnen Einzelinstallationen von Solarpaneelen quasi schenkt.
Eigene Photovoltaik-Industrie für Indien
Dennoch geht die Internationale Energie Agentur (IEA) in ihrem Renewables Report 2022 durchaus davon aus, "dass die dezentrale Photovoltaik dank des wachsenden Bewusstseins der Verbraucher und einer anhaltenden politischen Unterstützung zunehmend an Bedeutung gewinnen wird."
Doch Indien will noch mehr, nämlich eine eigene Photovoltaik-Industrie aufbauen. Natürlich auch, um eines Tages den preiswerten Anlagen aus China international auch auf den Exportmärkten Paroli bieten zu können. Das wird nicht leicht, wie die IEA konstatiert: "Höhere Investitionskosten in Indien sind der Hauptgrund für den Kostenunterschied zu China."
Die indischen Produktionskapazitäten für Solarmodule würden derzeit zwar ausreichen, den Bedarf in den kommenden Jahren zu decken, so die IEA, doch basierten die angebotenen Module häufig auf veralteter Technologie.
Branchenexperten von Mercom, einem indischen Energieberatungsunternehmen, sehen außerdem Lücken im Fachwissen. Deshalb müsse mehr in Forschung und Entwicklung investiert werden. Beispielsweise geben große chinesische Solarzellproduzenten bis zu 5 Prozent ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Die indischen Hersteller sind davon noch weit entfernt. Hinzu komme, dass aktuelle Ausrüstung importiert werden müsse, wovon übrigens auch deutsche Solarzellenausrüster profitieren, wie Centrotherm. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, eine Solarzellen-Produktionslinie mit einer Kapazität von 4 GW an Indien zu liefern.
Subventionen, um Investitionslücken zu schließen
Jüngste politische Maßnahmen in Indien zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie durch Subventionen und Steuernachlässe zu erhöhen. Ein produktionsbezogenes Anreizsystem (PLI) der Regierung sieht inzwischen eine Subvention zur Senkung der Investitionskosten für Herstellungsfabriken vor. Schätzungen der IEA zufolge schließt die PLI-Unterstützung fast 80 Prozent der Investitionskostenlücke zwischen den indischen und den günstigsten chinesischen Herstellern. Es sind jedoch nur einmalige Subvention, was bedeutet, dass Effizienzsteigerungen in der Produktion durch Mengenvorteile ergänzt werden müssen, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Eigentlich hätte Indien auch die Chance, der Initiative "Just Energy Transition Partnership" beizutreten, die die G7-Staaten im Sommer 2022 in Leben gerufen hatten. Damit soll Entwicklungsländern geholfen werden, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Südafrika, Indonesien und Vietnam nahmen diese Möglichkeit wahr. Indien zögert jedoch. Denn zum einen werden die durchschnittlich erst zehn Jahre alten Kohlekraftwerke noch viele Jahre gebraucht, zum andern scheut sich die Regierung in erster Linie vor neuen Schulden und der Abhängigkeit von den G7-Staaten.
Denn die Initiative vergibt keine Geschenke. Im Falle Südafrikas wurden nämlich 97 Prozent der Zuwendungen nur als Kredite vergeben, wie die Financial Times berichtete. Das erhöhte die Schuldenlast Südafrikas ohne die Anpassung an den Klimawandel nennenswert zu fördern.
Update, 21.7.2023, 11 Uhr: Dieser Text erschien erstmals am 14.6.2023 online. Anlässlich der Indien-Reise von Bundeswirtschaftsminister Roboert Habeck veröffentlichen wir ihn mit aktuellem Bezug.
(jle)