EU-Verordnung: 1-Stunden-Löschfrist für terroristische Inhalte tritt in Kraft
Terrorpropaganda muss nach einer Entfernungsanordnung gelöscht werden. Egal, von welcher Behörde sie stammt. Ab Juni 2022 gilt eine strenge Frist.
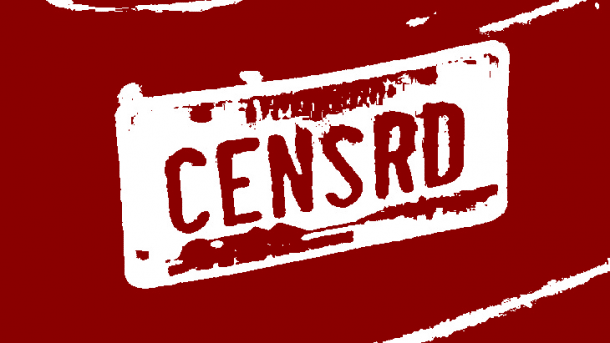
(Bild: Daniel AJ Sokolov)
Die umstrittene EU-Verordnung, wonach Betreiber von Online-Plattformen künftig "terroristische Inhalte" auf Anordnung beliebiger Behörden aus einem Mitgliedsstaat innerhalb einer Stunde löschen müssen, ist am Sonntag in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten und die betroffenen Internetdienstleister haben nun ein Jahr Zeit, ihre Prozesse anzupassen. Die Vorschriften gelten dann vom 7. Juni 2022 an. Sie sind direkt anwendbar, eine Umsetzung ins nationale Recht ist nicht zwingend erforderlich.
Terroristen soll es mit der Initiative künftig schwerer fallen, das Internet zu missbrauchen, um radikale Ansichten zu verbreiten, Anhänger zu rekrutieren und diese zu Gewalt zu·hetzen. Das EU-Parlament hatte den entsprechenden Entwurf Ende April ohne finale Abstimmung im Plenum auf Basis einer Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres angenommen.
Die Löschbefehle können sich 32021R0784:laut der Verordnung auf Texte, Bilder sowie Ton- oder Videoaufnahmen inklusive Live-Streaming beziehen, die zu terroristischen Taten anstacheln oder Anleitungen für den Bau von Bomben oder Waffen enthalten.
Schwere Aufgabe für Betreiber
Internetplattformen werden zwar nicht verpflichtet, den gesamten Datenverkehr zu überwachen. Wenn auf ihnen aber bereits terroristische Inhalte veröffentlicht wurden, müssen sie besondere Maßnahmen ergreifen, um ihre Dienste vor deren weiteren Verbreitung zu schützen. Die Mittel können die betroffenen Firmen selbst wählen.
Ausdrücklich gibt es keine Vorgabe, "automatisierte Werkzeuge" zu verwenden. Dies konnten die Abgeordneten durchsetzen, um Upload-Filter nicht obligatorisch zu machen. Entfernungsanordnungen können von jedem Mitgliedstaat an jede in der EU niedergelassene Online-Plattform gerichtet werden. Dies betrifft auch große Anbieter wie Amazon, Facebook, Google mit YouTube, TikTok und Twitter. Ein unabhängiger Richter muss nicht befasst werden.
"Der größte Schaden durch terroristische Inhalte entsteht in den ersten Stunden nach ihrem Erscheinen", hat die EU-Kommission den Ansatz gegen Zensurvorwürfe von Bürgerrechtlern verteidigt. Die neuen Vorschriften verpflichten Plattformen, "die Verbreitung solcher Inhalte so früh wie möglich zu stoppen". Prinzipiell ausgenommen seien Inhalte, die zu Zwecken von Bildung und Forschung sowie in den Bereichen Journalismus und Kunst verbreitet würden. Ferner gebe es Beschwerdemechanismen, damit irrtümlich entfernte Beiträge "möglichst schnell wiederhergestellt werden können".
Europol soll koordinieren
Das Gesetz sieht verstärkte Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden und Europol vor, damit Entfernungsanordnungen besser nachverfolgt werden können. Das Europäische Polizeiamt koordiniert schon jetzt Löschanträge aus den Mitgliedsstaaten über die gemeinsame "Internet Referral Management Application" (Irma). Daneben betreibt es eine eigene Stelle für einschlägige Hinweise an Internetprovider.
Ende Mai veranstaltete diese Stelle erstmals einen Aktionstag gegen rechtsextremistische Terrorpropaganda mit Partnern aus der EU sowie aus Drittstaaten, darunter Australien und die USA. Insgesamt haben die Ermittler dabei 1038 Elemente an Diensteanbieter weitergeleitet, mit der Bitte, sie anhand ihrer Nutzungsbedingungen zu überprüfen. Kritiker wie die Betreiber von Archive.org bemängeln, dass es sich bei vielen der beanstandeten Inhalte nicht um Aufrufe zum Terrorismus handle. Sie befürchten massive Kollateralschäden der Verordnung.
Der für europäischen Lebensstil zuständige Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas sprach von "bahnbrechenden neuen Regeln", die die EU-Sicherheitsunion ein Stück weiter verwirklichen würden. Plattformen müssten künftig sicherstellen, "dass Anschläge wie der in Christchurch nicht dazu genutzt werden können, Bildschirme und Gedanken zu verschmutzen". Zivilgesellschaftliche Organisationen hatten nach dem Beschluss des Gesetzes dagegen vor einem "schweren Schlag für die Meinungs- und Pressefreiheit" gewarnt. Es fehlten grundlegende Sicherungen gegen Missbrauch oder bloße Anwendungsfehler.
(ds)