Lauterbach will "modernstes Datengesetz" mit "supersicherer Verschlüsselung"
Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht die Datennutzung im Medizinbereich als alternativlos. KI-Modelle will er dafür "mit synthetischen Daten durchspülen".
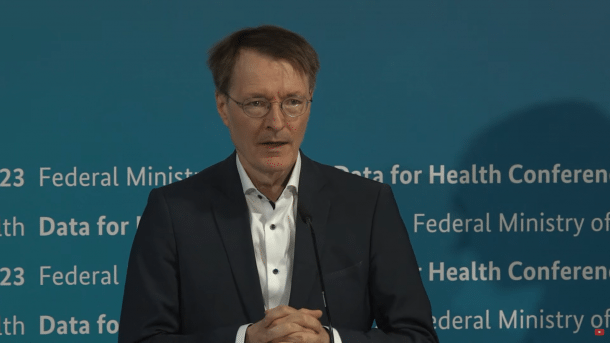
Karl Lauterbach
(Bild: BMG)
Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das "modernste Datengesetz" samt "supersicherer Verschlüsselung" schaffen, das es in Europa gibt. Bei deren Auswertung sollen, wie bereits mehrfach angekündigt, auch Methoden Künstlicher Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Geplant sei ein Austausch von Gesundheitsdaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union sowie das Trainieren von großen Sprachmodellen mit derartigen Daten. Die Daten nicht mit den USA auszutauschen, sei keine Option, sagte der Minister.
Für die Vorhaben brauche es ein Umfeld, in dem Daten legal und vertrauensvoll verwendet werden können – "unter höchsten ethischen Standards", betonte Lauterbach bei der Eröffnung der zweitägigen "Data for Health Conference" in Berlin. Diese hat das BMG zusammen mit Professor Jochen Lennerz von der Harvard Medical School in Boston ins Leben gerufen, um über die aktuellen Probleme, Rahmenbedingungen und "wie Daten sicher bleiben, aber trotzdem mehr Forschung möglich wird" zu diskutieren.
Transatlantischer Austausch von Gesundheitsdaten
Dafür sollen möglichst bald Richtlinien – etwa auch eine Helsinki-Deklaration für die internationale Datennutzung – erarbeitet werden. Abstimmungen beim Datenschutz unter den Bundesländern sollen künftig ebenfalls nicht mehr notwendig sein. Laut Referentenentwurf des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes wird sich um die Koordination eine beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angesiedelte "nationale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle" kümmern. Dem Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zufolge ist es aktuell "nur schwer möglich", mit den sensiblen Daten zu forschen, bisher gibt es auch keine Regelungen für den transatlantischen Datenaustausch. Bei der Datenübertragung sei jedoch "nicht jede Form der Ende-zu Ende-Verschlüsselung" möglich.
Damit die Daten der Versicherten nicht gefährdet werden, will Lauterbach die KI-Systeme "mit synthetischen Daten durchspülen [...] wie eine neue Heizung, die man sich kauft". Für die Motivation zur Datenspende müssten die Versicherten zudem einen Nutzen spüren – etwa, dass sich möglicherweise irgendwo im Körper ein Tumor befinden könnte. Dann werde keiner sagen, dass er seine Daten nicht spenden will, so Lauterbach.
Digitalgesetz, Gesundheitsdatennutzungsgesetz
Derzeit sind ein Digitalgesetz, Gesundheitsdatennutzungsgesetz – von denen inzwischen Referentenentwürfe aufgetaucht sind – sowie ein Digitalagenturgesetz in Arbeit. Wichtig sei Lauterbach zufolge die Interoperabilität, welche transatlantische Regelungen und ethischen Grundlagen, etwa für die Sekundärnutzung, beachtet werden müssen. Dafür seien einfache Regelungen notwendig. Gäbe es die Gesetze schon, hätten KI und der Europäische Gesundheitsdatenraum (EHDS) nicht mitgedacht werden können. "Wir werden das modernste Digitalsystem in Europa haben", so Lauterbach.
Künftig sollen die Daten mittels KI einfacher und intuitiver zusammengefasst, aber auch besser ausgewertet werden. Dennoch würde es immer schwerer zu verstehen, wie die Algorithmen funktionieren, da Modelle wie GPT-4 sich selbst trainieren. Das berge Risiken der Intransparenz. Sobald Deutschland "EHDS-ready" sei, soll der Datenraum laut Lauterbach auch direkt einsatzbereit sein.
Seltene Diagnosen
Als Beispiel für sinnvolle Datennutzung nannte Lennerz eine 14-jährige, schwangere Brustkrebspatientin mit einer seltenen genetischen Veränderung im Tumor. Diese genetische Veränderung sind demnach oft ein seltenes Unikat. Alle Patienten mit ähnlichen Erkrankungen könnten durch die Datennutzung abgerufen werden und damit sei möglich, "informierte, therapeutische Entscheidungen [zu] treffen". Dafür sei ein Zugriff auf die erforderlichen Daten notwendig. Als weiteres Beispiel nannte er die übliche Odyssee für Lungenkrebspatienten. Die Diagnose und zielgerichtete Therapie für Lungenkrebspatienten seit mithilfe von KI an einem Tag zu schaffen, "wenn man das streamlined und mit künstlicher Intelligenz powered", sagt Lennerz.
Medizinische Dateninfrastruktur "unsanierter DDR-Dachboden"
Die durchschnittliche medizinische Dateninfrastruktur in Deutschland sei nach Ansicht von Lennerz analog zu einem "unsanierten DDR-Dachboden". Unsaniert bedeute in diesem Fall, dass es ein riesiges Potenzial gebe. "DDR, weil die Idee und die Umsetzung gar nicht so leicht sind". Auf dem Dachboden hingegen lagerten "die wichtigsten Sachen" der Menschen, von denen ein "unendliches Potenzial ausgeht", an das wir momentan nicht herankommen. Demnach würden wir etwas schützen, von dem die meisten Patienten gar nicht wissen, wofür es gut sei. Momentan hätten die Versicherten keinen Zugriff auf ihre eigene elektronische Patientenakte und trotzdem werde sie deutlich geschützt, kritisiert Lennerz. Daher gebe es hohe regulatorische Hürden.
Die Datenschutzgrundverordnung würde in den USA durchschnittlich nicht funktionieren. Dort gebe es einen Flickenteppich an Datenschutzrichtlinien. Die Datenschutzrichtlinien müssten in Deutschland auf Ebene der Bundesländer und in individuellen Krankenhäusern heruntergebrochen werden, sagt Lennerz. Das bezeichnete er als ein "erhebliches regulatorisches Problem". Hinzu kämen noch technische und finanzielle Probleme. Er will für dieses "fast schon beängstigendes Kompliziertes" eine magische Lösung: "Das Agieren im prekompetitiven Raum". Das bedeute, "wir sind hier nicht an kommerziellen Lösungen interessiert, sondern an praktischen Werkzeugen". Mit über 300 Experten aus ganzer Welt sollen im Rahmen der Konferenz daher Werkzeuge für transatlantische Datenaustausche geschaffen werden.
(mack)